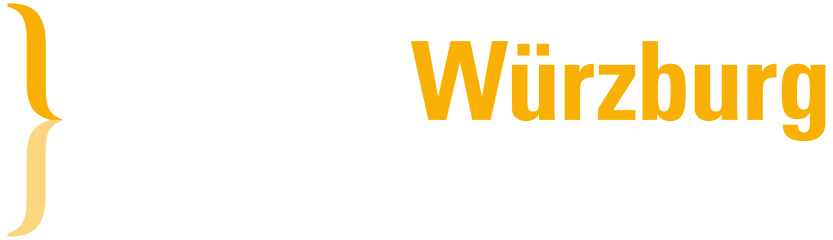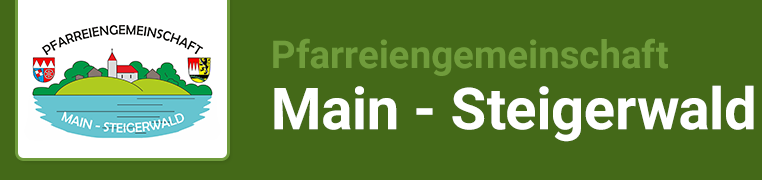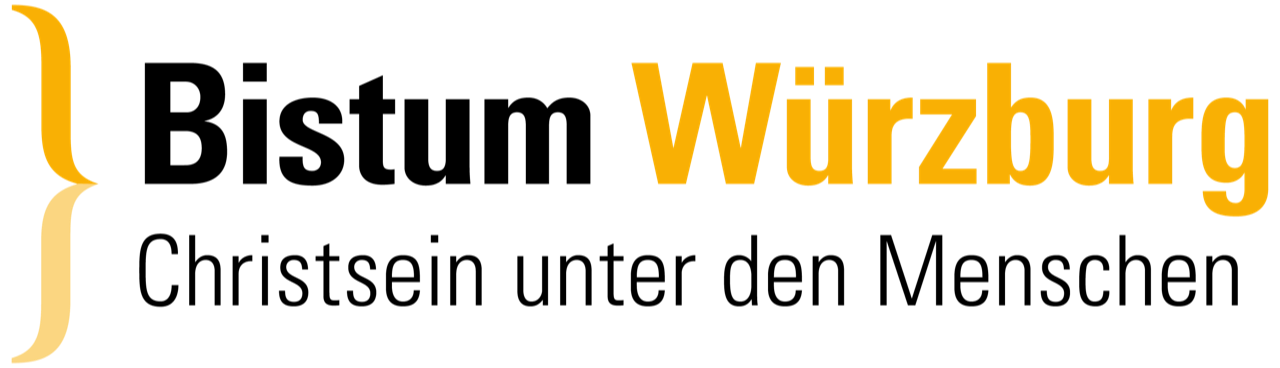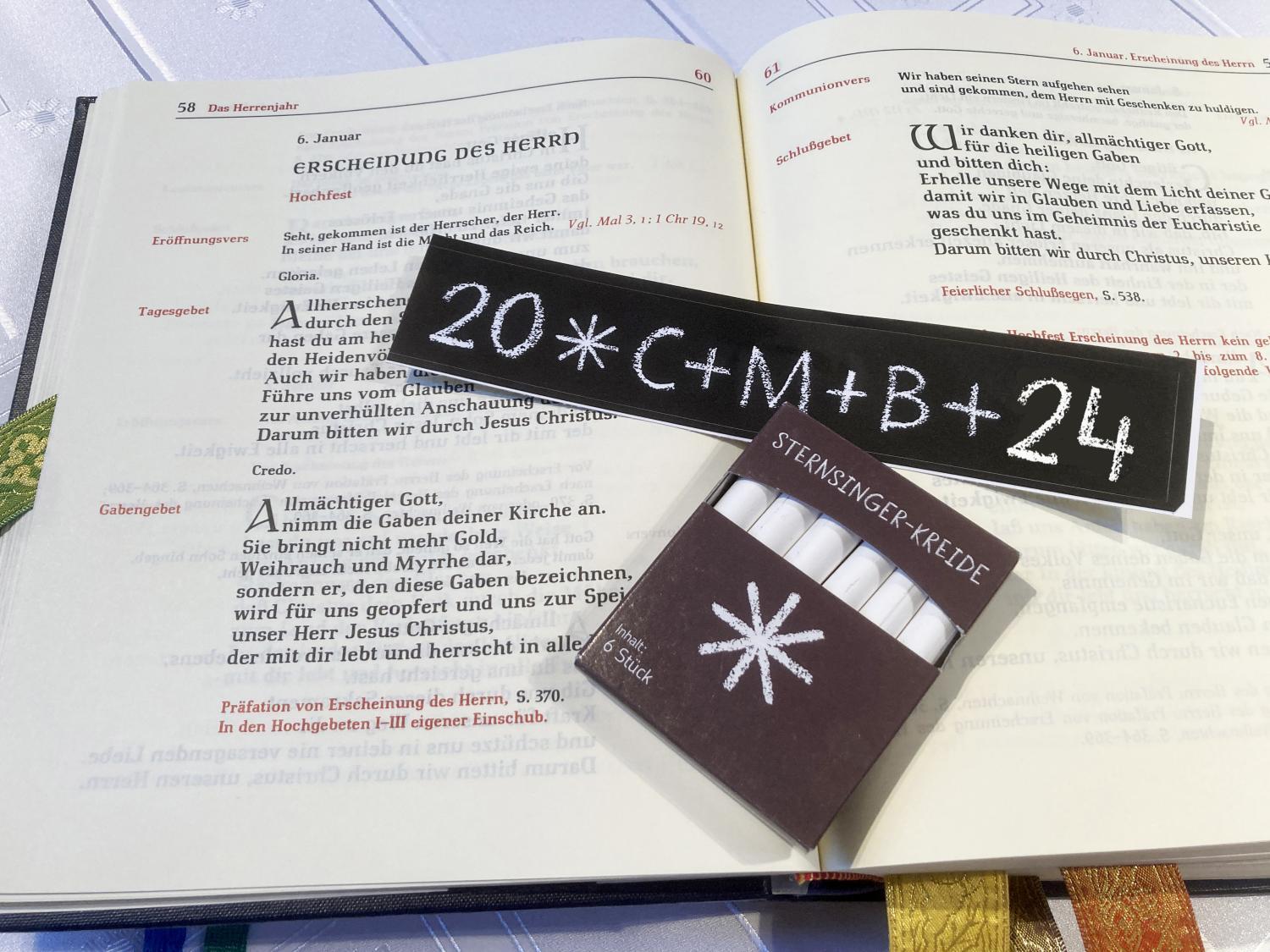Herzlich willkommen
auf den Internetseiten der Pfarreiengemeinschaft Main-Steigerwald
Termine
Veranstaltungskalender
Alle Ergebnisse (0)
Nachrichten
Gottesdienste
Kontakt
Verwaltungsadresse
Pfarreiengemeinschaft Main - Steigerwald
Johannes-Nas-Platz 3
97483 Eltmann
Telefon: 09522 70 89 40
Fax: 09522 70 89 49
E-Mail: pg.main-steigerwald@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten
Eltmann
Montag bis Freitag
09:00 bis 12:00 Uhr
Montag & Mittwoch
13:30 bis 16:30 Uhr
Limbach
Mittwoch
09:00 bis 11:00 Uhr
Öffnungszeiten
der Pfarrbüros in
Oberschleichach
Montag
15:45 bis 17:00 Uhr
Trossenfurt
Montag
13:30 bis 15:30 Uhr
© 2024 Bistum Würzburg Impressum | Datenschutzerklärung | Erklärung zur Barrierefreiheit | Cookie-Einstellungen